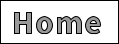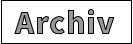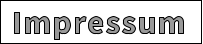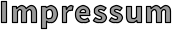Unabhängiger Journalismus in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
K-Punkt-Rottenburg
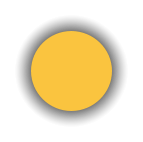
Kontakt: Redaktion k-punkt-Rottenburg
Youtube-Videos zum Thema
Missbrauch und Aufarbeitung


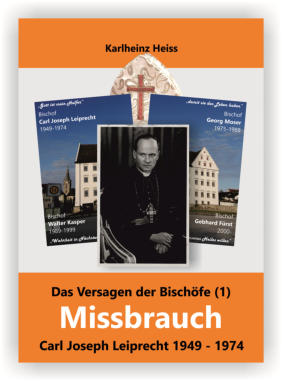
zu bestellen über:
#COM+Musik+Verlag Ammerbuch
Postfach 17
72117 Ammerbuch
und über mail:
com-musikverlag@web.de
Preis: 14,80 €
Wilhelm Treiber, Pfarrer
* 1886 + 1971


Recherchearbeit zu Pfarrer Treiber
Kann
es
sein,
dass
Pfarrer
Treiber
Kinder
sexuell
missbraucht
hat?
Dieser
Frage
geht
k-punkt-
rottenburg.de
derzeit
nach.
Interessant
ist
die
Antwort,
weil
der
Umgang
der
Diözese
unter
Bischof
Sproll
ins
Visier
kommt
und
damit
die
Frage,
ob
mit
Auswirkungen
auf
das
Seligsprechungs-
verfahren zu rechnen ist.
Unabhängiger Journalismus in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
K-Punkt
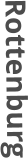

„Kein
begründeter
Verdacht
wird
vertuscht,
und
jeder
Täter
wurde
und
wird
zur
Rechenschaft
gezogen,
bestraft,
aus
der
Pastoral
herausgenommen
und
vom
Dienst suspendiert.“, sagte Bischof Fürst 2018.

Redaktion
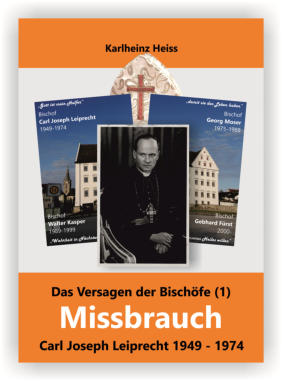
zu bestellen über:
#COM+Musik+Verlag Ammerbuch
Postfach 17
72117 Ammerbuch
und über mail:
com-musikverlag@web.de
Preis: 14,80 €
Wilhelm Treiber, Pfarrer
* 1886 + 1971


Recherchearbeit zu Pfarrer Treiber
Kann
es
sein,
dass
Pfarrer
Treiber
Kinder
sexuell
missbraucht
hat?
Dieser
Frage
geht
k-punkt-rottenburg.de
derzeit
nach.
Interessant
ist
die
Antwort,
weil
der
Umgang
der
Diözese
unter
Bischof
Sproll
ins
Visier
kommt
und
damit
die
Frage,
ob
mit
Auswirkungen
auf
das
Seligsprechungs-verfahren zu rechnen ist.